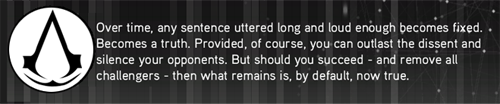Hallo zusammen,
nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder ein paar Zeilen zustande gebracht - eine solide Geschichte mittlerer Länge.
Ich bitte zu Tisch - so seltsam habt ihr noch nie gegessen.
Frische Quelle
Was als angenehmer Tag begonnen hatte, schien nun in einem Desaster auszuarten. Herr S. fluchte. Es passierte sonst nie, dass er sein Handy vergaß. Üblicherweise kontrollierte er alle Taschen, bevor er das Haus verließ, nur heute, nur dieses einmal hatte er es unterlassen und dieser Fehler rächte sich nun gnadenlos.
Wieder schaute er auf die Tachoeinheit, wo bedrohlich die Motorkontrolleuchte in grellem Rot aufglomm. Er meinte zu spüren, dass der Motor nicht mehr richtig auf das Gaspedal reagierte und unrund schien er auch zu laufen. Doch mitten auf der Straße anhalten war undenkbar – es war dunkel, er befand sich mitten im Schwarzwald und darüber hinaus hatte er bei seinem Treffen mit einem Geschäftspartner, das nun erst zwei Stunden zurücklag, eine erhebliche Menge Wein getrunken, sodass es nicht in Frage kam, an einer Notrufsäule die Polizei zu kontaktieren. Andererseits – die Straße, auf der er nun mit seinem Mercedes dahinfuhr sah nicht so aus, als ob sie überhaupt Notrufsäulen hätte. Nicht einmal einen Mittelstreifen gab es. Einfach anhalten wäre äußerst gefährlich. Mehr und mehr gewann er den Eindruck, sich verfahren zu haben. Das Navigationssystem war keine Hilfe, es verkündete nur, er befände sich „außerhalb des erfassten Straßennetzes“.
Noch einmal fluchte S. und schlug auf das Lenkrad des Wagens. Dieser war erst sechs Monate alt und hatte ihn einiges gekostet – nachdem er schon über zwei Jahrzehnte eine E-Klasse von Mercedes gefahren hatte (stets ein Modell mit sparsamem Dieselmotor) hatte er sich nun eine S-Klasse gegönnt. Und da der Ruhestand nicht mehr fern war und er mittlerweile über die nötigen Mittel verfügte, hatte er es sich sogar gestattet, zum größten Modell zu greifen, zum legendären „Sechshunderter“, von dem er bereits seit Kindheitstagen geträumt hatte. Die ersten sechs Monate verliefen traumhaft: S. war restlos zufrieden und begeistert von dem Wagen gewesen. Bis jetzt. In der Stadt wäre es kein Problem gewesen, er hätte den Wagen abschleppen lassen können. Auch hier im Schwarzwald hätte er es sich einfach machen können – ein Anruf hätte genügt. Doch sein Handy lag nun dort, wo es ihm am wenigsten nutzte – zu Hause auf der Garderobe.
Ein deutlicher Ruck ging durch das Fahrzeug und S. wurde panisch. Es schien nicht unwahrscheinlich, dass das Auto binnen Minuten schlichtweg liegen bleiben würde. Was dann? Ein Warndreieck war alles, was er bei sich hatte. Nicht einmal eine Taschenlampe war im Handschuhfach. Er umklammerte das Lenkrad fester und sah nach vorne, wo das grelle Scheinwerferlicht die monotone Kulisse aus Tannen und Steinen erleuchtete.
Plötzlich zeichnete sich ein Schild gegen die Dunkelheit ab: „Gaststätte Frische Quelle – 300m rechts“.
Sofort reagierte S. und setzte den Blinker. Eine Gaststätte! Mit so einem Glücksfall hatte er nicht zu rechnen gewagt; er würde telefonieren können, sein Auto parken können und vielleicht noch etwas zu Trinken bekommen, obwohl es schon fast 23 Uhr war. Gerade als er auf den gekiesten Parkplatz einbog, begann die Drehzahl stark abzufallen. Auf dem Tachometer erschien nun die Meldung „MOTORSTÖRUNG. TEMPO AUF 25 KM/H BEGRENZT. SOFORT WERKSTATT AUFSUCHEN.“
„Keine Sekunde zu früh.“, flüsterte er in die Stille der großen Limousine. Er parkte, stieg aus, verschloss den Wagen und sah sich um. Der kleine Parkplatz war abgesehen von seinem Auto komplett leer. Die Gaststätte selbst war ein kleines, verkommen aussehendes Blockhaus. Es brannte kein Licht. Eine eisige Kälte stieg in S. hoch – wie konnte er nur so naiv sein? Es war offensichtlich, dass die „Frische Quelle“ bereits geschlossen hatte. Dies schien auch nicht verwunderlich, immerhin war es bereits Nacht und so wie es aussah, hielten ohnehin nur selten Leute an dieser Straße, sodass wenig Hoffnung bestand.
„Man kann’s ja mal probieren.“, dachte er niedergeschlagen und schlurfte zur hölzernen Eingangstür die ein kleines, gelbliches Fenster aufwies. Er drückte die eiserne Türklinke lustlos herunter.
Die Tür ging zu seiner Überraschung auf, auch wenn sie dabei hässlich quietschte.
Langsam trat S. in den Gastraum, wobei er sich peinlich vorkam. Alles war nur sehr schwach erleuchtet; die einzige Lichtquelle war eine bräunliche Glühbirne an der dunkelbraunen Holzdecke. Kein Gast war weit und breit zu sehen. Kein Tisch war gedeckt.
S., der ohnehin nicht vorhatte hier zu essen, holte tief Luft und rief dann laut vernehmlich: „Hallo?“
Nichts tat sich. Das war verwunderlich. Oder hatte man einfach vergessen, die Türe abzuschließen?
„Hallo?“, fragte er noch einmal.
Plötzlich öffnete sich eine Tür hinter der nur rudimentär eingerichteten Bar. Ein sehr alter Mann kam zu ihm heran gehumpelt. Er war gekleidet wie ein Oberkellner der gehobenen Gastronomie. S., der gerne teure Restaurants besuchte, kannte diese Aufmachung nur zu gut und hätte fast aufgelacht, den Wirt einer solch schäbigen Gaststätte in solch einer Montur anzutreffen, wenn die Stimmung nicht so bedrückend gewesen wäre.
„Sie wünschen?“, fragte er Wirt mit öliger Stimme, die in S. Ohren einen seltsamen Akzent aufwies, den er keinem Land zuordnen konnte.
„Ich… ich würde gerne telefonieren, wenn dies möglich ist. Sie müssen wissen, mein Wagen ist liegen geblieben… Tja…“
Der Mann sah ihn durchdringend und scharf an. Dabei verharrte er in gebeugter Haltung, wie ein Butler, ohne jedoch eine Miene zu verziehen.
S. wartete auf eine Antwort.
Nichts geschah.
„Entschuldigung, wenn ich Sie störe, aber dürfte ich telefonieren? Ich kann ihnen auch etwas dafü-“
„Sie telefonieren.“, antwortete der Wirt. Es klang nicht wie eine Erlaubnis, sondern wie ein Befehl. „Aber vorher werden Sie essen.“
Verwirrt lachte S. auf. Er fühlte eine seltsame Angst in sich hochsteigen – in dieser seltsamen Gaststätte alleine zu Abend zu essen war das Letzte was er wollte.
„Oh, vielen Dank!“ Beschwichtigend hob er die Hände. „Aber ich habe bereits gegessen. Ich müsste nur kurz telefonieren. Ich gebe ihn gerne etwas Geld dafür!“
Wieder sah ihn der Wirt nur durchdringend an. S. gekünsteltes Lächeln fiel in sich zusammen.
„Der Herr isst zu Abend.“
„Nein! Hören Sie, ich will nur- Ich gebe ihnen- Wie viel Geld wollen Sie?“ Er konnte nicht verleugnen, dass er nun zornig wurde. Er war bereit, diesem seltsamen Mann zehn, zwanzig oder sogar fünfzig Euro für ein simples Telefongespräch zu bezahlen. Wieso war er so erpicht darauf, ihn zu dieser späten Uhrzeit zu bewirten? Als der Bucklige weiterhin nichts tat, außer ihn anzustarren (S. hatte den Eindruck, als müsste er ein Grinsen unterdrücken), konnte er nicht mehr an sich halten. Er zog seinen schweren Geldbeutel wie eine Waffe, riss einen Fünfziger heraus und hielt ihn ihm dem Wirt unter die Nase.
„Fünfzig Euro! Bitte! Lassen Sie mich telefonieren!“
Der Wirt wandte sich ab. Plötzlich wurde S. bewusst, dass das Telefon der „Frischen Quelle“ womöglich das einzige in vielen Kilometern Umkreis war. Einen Rauswurf zu riskieren wäre wohl sehr unklug. Nun war ihm alles egal, wenn es denn sein musste, würde er auch essen.
„Tut mir leid, in Ordnung! Ich kann auch etwas-“
Wieder unterbrach ihn der Wirt mit seiner seltsam klingenden Stimme.
„Ihr Tisch.“
Mit ausholender Geste wies er auf einen prachtvoll eingedeckten Tisch, der in einer dunklen Ecke des Restaurants stand. S. blieb der Atem stehen. Derartiges hatte er bisher nur in den nobelsten Restaurants gesehen.
Der Tisch sah inmitten der anderen, ungedeckten Tische aus wie aus einer anderen Welt. Auf einer schweren, blütenweißen Tischdecke stand genau ein Gedeck, bestehend aus einem dreiteiligen Besteck, einer kompliziert gefalteten Serviette und mehreren Weingläsern. S., der erfahrener Weinkenner- und Sammler war, erkannte sofort, dass sowohl für Aperitif, Weißwein und für schweren Rotwein ein Glas vorhanden war. Wie zur Krönung brannte inmitten der Tafel eine Kerze, die die Szenerie in ein warmes, gelbliches Licht tauchte.
S. musste blinzeln. Wie war dies möglich? Wie konnte es sein, dass ihm beim Hereinkommen dieser prachtvolle Tisch entgangen war? Sprachlos schüttelte er den Kopf, setzte sich dann aber doch langsam in Bewegung.
Ich muss es übersehen haben, sagte er sich. Der Gastraum, der beim Betreten dunkel und klein gewirkte hatte, wirkte nun geräumig und wegen einiger hölzerner Stellwände sogar ein wenig unübersichtlich. Jetzt, wo S. die Szenerie ein wenig auf sich wirken ließ, wirkte es gar nicht einmal so unglaubwürdig, dass er den Tisch übersehen hatte.
Allerdings, so regte sich nun seine Skepsis, konnte der Wirt doch unmöglich von seiner Ankunft gewusst haben. Während der Bucklige ihn zu seinem Tisch geleitete, fragte S. möglichst beiläufig:
„Woher haben Sie gewusst, dass ich komme?“
„Es lag eine Reservierung für Sie vor.“, kam prompt die Antwort. „Es ist nicht meine Art, Tische für Leute bereit zu halten, für die keine Reservierung vorliegt.
Dann wandte sich der Wirt wieder dem Tisch zu, als wäre mit diesen zwei Sätzen alles gesagt.
Mit perfekten Manieren zog der Wirt, der nun auch Ober und Diener in einer Person war, den Stuhl zurück und nahm S., der alles sprachlos geschehen ließ, galant seinen Mantel ab. Dann verschwandt er wortlos in der Küche.
S. griff verdattert das Besteck, das sich als schweres Silberbesteck erwies. Der Unterteller war teures Rosenthal-Porzellan. Die ganze Situation ängstigte ihn, aber amüsierte ihn zugleich. Seinen Wagen und den Telefonanruf hatte er völlig vergessen.
Plötzlich kam der Wirt – den S. nun als Ober wahrnahm – aus einer Tür, die wohl zur Küche führte. Ohne sich darüber zu wundern, welches Personal denn um diese Zeit für einen einzigen Gast kochen möge, war S. gespannt, was der fein gekleidete Ober ihm nun auftischen Würde.
Das Gericht verbarg sich unter einer schweren Silberhaube.
„Dies, mein Herr, ist die Vorspeise.“, gab der Ober mit getragener Stimme bekannt. „Foie Gras auf einem Bett aus grünem Spargel, mit Tomatenmousse und gedünsteten Johannisbeeren. Wünscht der Herr einen passenden Wein?“
„J-ja.“ S. Antwort kam wie automatisch – Wein war der bestimmende Faktor in seinem Leben. Nicht nur war Wein seine größte Leidenschaft, sondern schließlich der Gegenstand seines Berufs. Seine Neugier wuchs, als der Ober wieder in der Küche verschwand. Die Vorspeise sah absolut makellos aus und roch verführerisch. S. hatte den Eindruck, sich in einem Traum zu befinden, so surreal erschien ihm all dies. Doch er wagte noch nicht, das Essen anzurühren.
Der Ober kam wieder, mit einer kleinen Flasche Wein in der Hand. S. erkannte das Etikett sofort und er meinte, sein Herz müsse stehen bleiben.
Ohne große Emotionen verlas der Ober den Namen des Weines: „Château d’Yquem 1972.“
„Sie machen Witze, oder?“, stammelte S. „So viel Geld will ich dann doch nicht ausgeben.“
S. wusste, dass dieser Wein mindestens 1500 Euro kosten würde – Château d’Yquem war immerhin der beste Süßwein der Welt. In seinem ganzen, langen Leben hatte er lediglich zwei oder drei Flaschen getrunken und jede davon war ein Erlebnis gewesen.
Doch der Ober antwortete nur: „Unser Hauswein. Alles bezahlt.“
„Bezahlt von wem?“, brachte S. nur hervor.
Der Ober ging nicht darauf ein, sondern schenkte wortlos die goldgelbe, schwere Flüssigkeit in das bereitgestellte Kristallglas.
Nun denn, dachte S., einen Yquem soll man nicht verachten.
Vorsichtig nippte er am Glas und war sofort von den Aromen überwältigt. Er schloss die Augen, um dieses Erlebnis in vollen Zügen zu genießen und der Gedanke an den ausstehenden Telefonanruf bei seiner Mercedes-Benz-Werkstatt war in weite Ferne gerückt.
Er schob ein Stückchen der Gänsestopfleber in den Mund und musste feststellen, dass es die beste war, die er jemals gegessen hatte. Es dauerte nur eine Viertelstunde, bis er die Vorspeise gegessen hatte und der zugehörige Wein ausgetrunken war.
Gerade als er die Gabel niederlegte und sich den letzten Bissen auf der Zunge zergehen ließ, kam der Ober so leise heran, dass er ihn nicht hörte, bis er neben ihm stand. Behände hob er den Teller vom Tisch und fragte dann, ob S. einen Rotwein zum Essen wünsche. S. bejahte, mittlerweile fröhlich und fast ein wenig ausgelassen. Von der seltsamen Stimmung war nichts mehr zu spüren, es war, als hätte der großartige Wein alle Bedenken aus seinem Bewusstsein beseitigt.
Der Ober verschwand und kam nach kurzer Zeit wieder. In der Hand trug er eine Flasche Wein, die in einem silbernen Korb steckte. Mit geübten Griffen öffnete er sie vorsichtig und goss dann ein wenig in S. Glas, damit dieser verkosten konnte.
S. benötigte nicht lange für sein Urteil – schon als der Wein ins Glass floss, breitete sich ein herrlicher Geruch aus, wie er ihn bisher nur bei den besten Weinen kennengelernt hatte. Nachdem er die tiefdunkelrote Flüssigkeit ein paar Mal im Glas geschwenkt hatte, setzte er es vorsichtig an die Lippen und nahm einen kleinen Schluck.
Es war überwältigend.
Er schloss die Augen und nahm einen zweiten, diesmal etwas größeren Schluck.
Ohne Zweifel war dies der beste Wein, den er in seinem langen Leben getrunken hatte. Ohne Zweifel handelte es sich um einen Bordeaux, um einen großen, französischen Rotwein. Während er den Schluck im Mund kreisen ließ, schien die Zeit still zu stehen – immer neue Aromen taten sich auf; die Vielfalt des Weines schien kein Ende zu kennen. Es musste sich um einen der größten Châteaux handeln – Mouton, Lafite, oder vielleicht sogar…
„Château Latour…“, flüsterte S. in die Stille des Restaurants.
Dann schlug er die Augen auf und sah, dass der Ober sogar ein klein wenig lächelte.
„Der Herr ist Weinkenner.“, sagte er knapp und schenkte dann vorsichtig den Inhalt der Flasche in eine bereitgestellte Kristallkaraffe. Als diese gefüllt war, zog er die nun leere Flasche aus dem Silberkorb und stellte sie auf den Tisch. Dann entfernte er sich wieder.
S. kniff die Augen zusammen, um das Etikett lesen zu können, das nur schwach von der Kerze beleuchtet wurde. Tatsächlich, es war eine Flasche Latour.
Er strengte sich noch weiter an, um den Jahrgang erkennen zu können.
„Mein Gott, der 61er.“
Obwohl es unmöglich schien, handelte es sich bei dem Wein um einen 1961er Château Latour, von dem S. wusste, dass er von einigen renommierten Weinkritikern als der beste jemals hergestellte Rotwein angesehen wurde. Seltsamer als die schon absurd erscheinende Tatsache, diesen Wein in einem kleinen Gasthaus im Schwarzwald anzutreffen, war allerdings die Farbe des Weins: Ein dunkles, kräftiges Granatrot. Auf Raritätenverkostungen hatte S. bereits mehrere Weine der Sechzigerjahre verkostet und Weine dieses Alters waren in der Regel schon dunkelbraun, im besten Falle hellrot. Er schüttelte den Kopf und zog die Flasche näher zu sich heran. Kein Zweifel.
Die Flasche wirkte wie neu, das Etikett war makellos – bis auf ein wenig Ruß. Bei näherem Hinsehen bemerkte S., dass eine Ecke des Etiketts ein wenig angesengt war. Eine Fälschung? Das schloss S. aus, denn die Qualität des Weines sprach für sich.
Plötzlich wurde ihm klar, dass der Wer dieser Rarität bei mehreren Tausend Euro liegen musste. Wie sollte er das bezahlen?
Der Ober riss ihn aus seinen Gedanken, als er wieder zum Tisch kam, mit einem weiteren, mit Silberhaube bestückten Teller in der Hand.
„Rinderfilet vom Kobe-Rind an einer Portweinjus. Dazu pommes gratinées und eine Trilogie pürierter Tomaten. Ich wünsche wohl zu speisen.“
„Einen Moment bitte!“, warf S. ein.
Der Ober schien zuerst nicht darauf einzugehen, hielt aber dann doch inne.
„Entschuldigen Sie, eine Frage… Es geht um den Wein. Keine Sorge, er ist exzellent! Aber ein 61er Latour, diese Flasche muss doch ein Vermögen gekostet haben. Muss ich das denn nicht bezahlen?“
Wie schon bei der vorherigen Flasche, die er zur Gänsestopfleber genossen hatte, sagte der Ober nur knapp: „Hauswein. Alles bezahlt.“
„Vielen Dank.“, murmelte S. verblüfft. Mehr als Fragen konnte er ja nicht.
Dann wandte er sich dem Essen zu.
Wie schon die Vorspeise übertraf es seine kühnsten Erwartungen – er wusste, dass Kobe-Rind das teuerste Rindfleisch der Welt war und wir er nun feststellte, war es das zu Recht. Er konnte ein genussvolles Stöhnen kaum unterdrücken, als er das zarte Fleisch in kleinen Stücken zu sich nahm. Die Harmonie mit dem Wein war unübertrefflich; sein Urteil stand fest: Noch niemals hatte er so gut gegessen.
Mit jedem weiteren Glas Wein schien das Geschmackserlebnis intensiver zu werden. Wieder einmal schloss er die Augen und nahm einen Schluck des Latour. Die Schwere des Weines auf der Zunge spürend, meinte er nun, leise eine Klaviermusik wahrzunehmen. Leise, wie von weiter Ferne drang nun auch das Geklapper von Besteck an seine Ohren. Gesittete Stimmen führten ruhige, vornehme Unterhaltungen. Als er das Glas austrank, meinte er deutlich, ein feines Parfüm in der Nase zu haben.
Sowie er die Augen wieder öffnete, war mit einem Schlag alles verschwunden. Nur sein Tisch war nach wie vor vorhanden; eine prachtvolle Insel in dem ansonsten dunklen Gastraum. Obwohl das Lokal nun gespenstisch wirkte, verspürte S. keinerlei Unbehagen – das Essen war zu gut und beschäftige all seine Sinne. Nachdem er einige Minuten später das köstliche Mahl beendet hatte, fühlte er sich satt und schläfrig.
Doch plötzlich schreckte er hoch – irgendetwas Wichtiges war da in seinem Hinterkopf; etwas, das er unbedingt tun wollte. Doch was war es gewesen? Er konnte sich nicht erinnern. Wütend schüttelte er den Kopf. Hatte ihn der Wein schon so benebelt gemacht, dass er Teile seiner Erinnerung verlor?
Der Wagen, fiel ihm es dann mit einem Mal ein. Er musste dringend telefonieren! Die wohlige Zufriedenheit, die sich nach dem Essen eingestellt hatte, war nun verschwunden und eine leichte Panik breitete sich in ihm aus. Über die eigene Vergesslichkeit entsetzt schüttelte er den Kopf und sah sich dann nach dem Ober um. Er war nirgends zu sehen. Wie er es schon beim Eintreten getan hatte, rief er wieder „Hallo?“ durch den dunklen Gastraum.
Und tatsächlich erschien der Ober nur wenige Sekunden später wieder hinter der Theke.
„Ich muss telefonieren, das hatte ich Ihnen ja gesagt.“
Wieder sah ihn der Ober nur an. Dann sagte er:
„Das wird nicht mehr nötig sein, mein Herr. Man hat sich um Ihren Wagen gekümmert.“
„Was? Wie – wie meinen Sie das?“ Hatte er dem Ober überhaupt von der Panne erzählt gehabt? Wieder konnte er sich nicht erinnern; die Geschehnisse des Tages verblassen bereits in seinem Kopf.
„Ich will sofort bezahlen!“, sagte er bestimmt.
Der Ober kam auf ihn zu und räumte beflissen das Geschirr ab, ohne darauf einzugehen.
„Ich will bezahlen!“, rief S. diesmal schärfer.
„Nicht nötig. Alles bezahlt.“
„Was soll das heißen?“
Klirrend setzte der Ober das Geschirr auf einen der ungedeckten Tische. S fuhr zusammen.
Der eisige Blick des Obers, dessen faltiges Gesicht nun halb im Kerzenlicht und halb ihm Schatten lag, schien ihn zu durchbohren.
„Alles bezahlt.“
S. traute sich nicht zu antworten Alles Nötige schien gesagt.
Das Essen war für ihn beendet.
Mit einem Mal ergriff eine irrationale Angst von S. Besitz. Panisch keuchend erhob er sich vom Tisch, so heftig, dass das Weinglas beinahe umkippte. Stählerne Bänder der Beklemmung schnürten sich um seinen Bauch.
Das Licht, bemerkte er. Etwas mit dem Licht war falsch, fundamental falsch. Mit geweiteten Augen betrachtete er, wie sich die Kerzenflamme im Porzellan spiegelte, wie ihr Schein flackerte, wie er stärker und schwächer wurde – das Gefüge der Realität schien dünner zu werden. Die Luft um ihn herum roch schal, alt und abgestanden. Das Etikett der Weinflasche sah plötzlich runzelig und verbrannt aus. Dann schien die Weinflasche zu schmelzen, als wäre das Glas aus zäher, brauner Melasse. Seine Hand streifte beim Aufspringen die Tischdecke – das Leinen war nicht mehr kühl und rau, sondern seltsam schmierig.
Er sah zum Ober – der jetzt unverhohlen grinste, so breit, dass es wie die Fratze eines Clowns aussah. Der Mond war aufgegangen; fahles, weißes Licht fiel durch die trüben Fenster der „Frischen Quelle“ und ließ seine Haut blass und leichenhaft wirken. Mit einem mal wusste S., dass es keine Haut war, sondern nicht mehr als eine Maske unter der sich etwas verbarg, dass möglicherweise sehr lange gewartet hatte und dessen wahre Gestalt nur im Mondlicht sichtbar sein würde.
So schnell es ging, machte er sich auf zur Tür, doch die Ausmaße des Gastraums schienen sich verändert zu haben. Statt einem Dutzend Tische waren es nun mindestens fünfzig – alle waren sie prachtvoll gedeckt, mit schweren Leinentischdecken und Silberbesteck, auf dem ein zentimeterdickes Leichentuch aus Staub lag. Wieder klangen das ferne Gelächter und die leisen Unterhaltungen in S. Ohren – akustische Rückkopplungen längst vergangener, längst vergessener, prachtvoller Orgien.
Unmittelbar hinter sich hörte S. die leisen Schritte des Obers, die ihn einzuholen drohten.
„Das Mahl ist noch nicht beendet.“
S. hatte die Tür erreichte und riss an der Klinke. Nichts bewegte sich.
„Das Mahl ist noch nicht beendet!“ Die Stimme des Obers, die nun anders klang – seltsam verzerrt, wie aus einem schlechten Radio – war direkt hinter ihm. S. wagte nicht, sich umzudrehen. Stattdessen rüttelte er weiter an die Klinke – plötzlich ging die Tür auf, als er an ihr zog, statt dagegen zu drücken.
Dann fielen zwei Eindrücke zusammen: In sein Gesicht fiel die eiskalte Nachtluft, die er gierig einsog, und gleichzeitig klammerte sich eine knochige, eiskalte Hand um seinen rechten Unterarm. Sein Herz schien stillzustehen. Mit aller Kraft preschte er nach vorne und kreischte den kreisrunden Vollmond an, gegen den sich die Silhouetten unzähliger, dunkler Tannen abzeichneten. Er stolperte und stürzte auf den Kies des Parkplatzes, während über seinen Kopf eine Stimmte hinweg donnerte, die keinesfalls mehr menschlich war:
„DAS MAHL IST NOCH NICHT BEENDET!“
Ohne zu bemerken, dass seine Hände vom Sturz blutig waren, rannte er zu seinem Wagen. Während des Laufs gestattete er sich einen letzten Blick auf die „Frische Quelle“: In den trüben Fenstern spiegelte sich der Schein tausender Kerzenflammen, sodass es aussah, als würde die Gaststätte von innen heraus brennen. Tanzende Gestalten wimmelten umeinander, zur lautlosen Musik einer längst vergangenen, rauschenden Ballnacht. Im Eingang, dessen Schwelle dieser offenbar nicht übertreten konnte, stand der Ober – seine Gesichtszüge zerflossenen nun wie eine schmelzende Gummimaske.
S. schrie nochmals, ohne es zu hören und richtete den Blick wieder nach vorne.
Dankenswerterweise öffnete der Wagen, als er den Griff mit seiner Türklinke berührte – ein Verdienst des Funkschlüssels den er in der Hosentasche trug. Mit zitternden Fingern startete er den Motor, der nun tadellos ansprang.
Kies spritzte in hohen Bögen, als er mit durchdrehenden Reifen den Parkplatz verließ.
Epilog
S. behielt nur bruchstückhafte Erinnerungen an die Heimfahrt. Als er zu Hause ankam, dämmerte es bereits, doch auch drang nicht zu seinem Bewusstsein durch. In seinen Ohren klang immer noch der letzte Aufschrei der unmenschlichen Stimme des Obers nach, der verkündete, dass das Mahl noch nicht beendet sei.
Die Geräusche von schwerem, klapperndem Silberbesteck und von spitzem Frauenlachen, das gepflegte Tischkonversation durchbrach, beherrschten seine Träume. Dazu hatte er den Eindruck, als läge ihm der Geschmack des Latour noch auf der Zunge – nur dass er jetzt pelzig, alt und abgestanden schmeckte.
Die Erinnerung an die Vorgänge selbst, schienen von Tag zu Tag schwächer zu werden – womöglich ein Selbstschutzmechanismus des Verstandes, der sich mehr und mehr einzureden versuchte, alles – oder zumindest das Meiste – sei Einbildung gewesen.
Wenige Tage später beschloss S., eine kleine Recherche durchzuführen, um mit dem Vorgang abzuschließen. Er suchte im Internet nach „Frische Quelle“ und war glücklich, nichts von Bedeutung zu finden. Damit war das Kapitel für ihn abgeschlossen.
Zwei Jahre später trat er wieder eine Fahrt in den Schwarzwald an – ein Besuch desselben Geschäftsfreundes, zu dem er auch an jenem Tag aufgebrochen war. Es dauerte eine Weile, bis ihm klar wurde, wieso er sich so unwohl fühlte und wieso die Silhouette von den allgegenwärtigen Schwarzwaldtannen bereits genügte, um seine Hände schwitzen zu lassen. Dann kamen die Erinnerungen wieder, eine nach der anderen. S. verfluchte sich, die Einladung angenommen zu haben.
Als er dann später mit seinem Freund zu Tisch war, fragte er möglichst beiläufig, ob er um eine Gaststätte namens „Frische Quelle“ wisse, das hier in der Nähe sein soll. Zu seiner Erleichterung schüttelte der Bekannte nur den Kopf.
Doch dann plötzlich hielt er inne: „Doch. Doch, der Name sagt mir was… Das Restaurant gab es mal. Ist schon lange her…“
„H-hat es mittlerweile geschlossen?“, fragte S. hektisch.
„Das kann man wohl sagen. Die ‚Frische Quelle’ war mal ein richtiges Gourmetrestaurant. Bis es dann lichterloh abgebrannt ist. Stand sogar in der Zeitung, über zehn Leute sind dabei umgekommen.“
S. keuchte nur. „Wann war das? Letztes Jahr?“
„Nein, viel länger her. Das war in den Siebzigerjahren. Dann haben Sie zuerst eine Tankstelle hingebaut. Wurde aber auch nichts draus, die Straße war kaum befahren. Kurze Zeit später hat die Ortsverwaltung beschlossen, die Straße komplett zu sperren, weil sie im Winter durch den vielen Schnee ohnehin kaum befahrbar war.“
Klimpernd fiel S. Whiskyglas auf den Boden.
„Was ist denn los? Du bist ja ganz blass!“
S. konnte nichts erwidern.
„Verträgst du noch was? Ich habe einen Wein besorgt, der bringt dich in Schwung.“ Sein Freund gluckste. „Du wirst es nicht glauben, bis du es siehst. Ich hätte niemals gedacht, eine Flasche davon zu bekommen.“
„Was?“, fragte S. mit brüsker Stimme.
„1961er Château Latour. Schau dir die Flasche an – wie neu! Der Bekannte, von dem ich sie habe, meinte zu mir, sie würde aus dem Keller irgendeines Restaurants stammen, die sie nicht verkauft bekommen haben – wohl zu teuer. Das weiß er aber auch nur sozusagen aus dritter Hand, er hat sie nämlich von einem alten Bekannten bekommen, der einmal selbst in der Gastronomie gearbeitet hat.“
Langsam hob S. den Blick und betrachtete die Flasche. In der Tat, wie neu. Bis auf das kleine Detail, mit dem er fast gerechnet hatte. Ein Eck des Etikettes war ein wenig angesengt. Er erkannte den Ruß wieder. Sofort stand ihm wieder der pelzige, fahle Nachgeschmack des Weines auf der Zunge, den er vor über zwei Jahren getrunken hatte.
Es schien, als sei das Mahl noch lange nicht beendet.






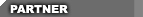






 .
.